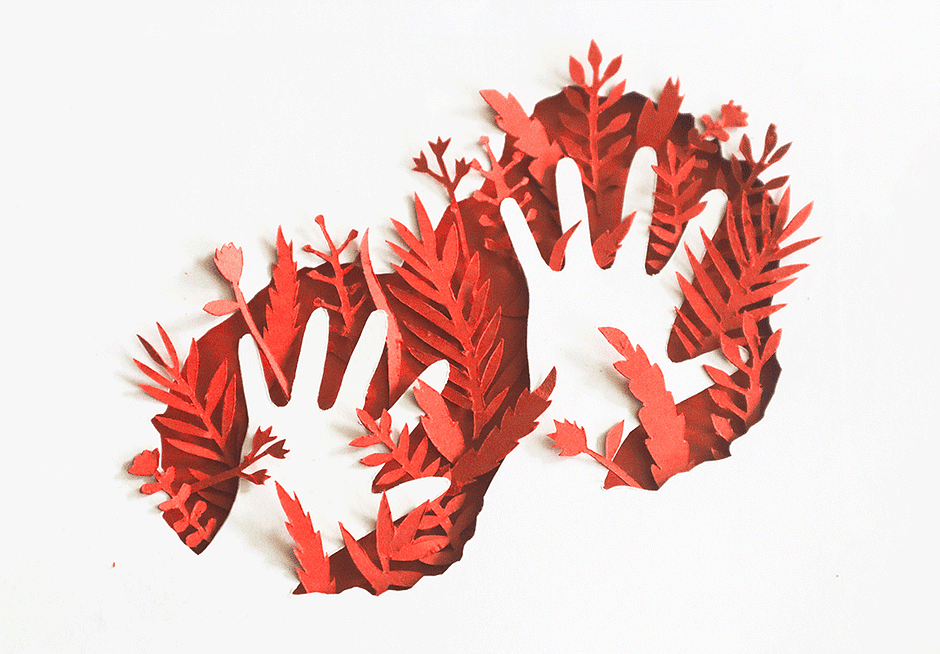Die zwei Gesichter des Naturschutzes

Von Stephen Corry, Direktor
Die Originalversion dieses Artikels erschien am 09. August 2015 auf Truthout.

Kinessa Johnson (Bild) sagt: „Wir werden etwas Anti-Wilderei betreiben, ein paar „von den Bösen“ umbringen und etwas Gutes tun.“ Wer könnte schon etwas dagegen einwenden? Frau Johnson ist Mitarbeiterin bei VETPAW, einer von einem Ex-Marine gegründeten Gruppe, die Veteraninnen und Veteranen nach dem 11. September 2001 Arbeit verschaffen soll. VETPAW finanziert sich über öffentliche Spenden und schickt Veteran*innen in afrikanische Länder wie etwa die Zentralafrikanische Republik. Dort sollen die ehemaligen Soldat*innen Wilderer ausschalten, die Berichten zufolge auch in terroristische Aktivitäten verwickelt sind. So soll dem Terrorismus die finanzielle Grundlage entzogen werden.
Es scheint, als würden alle Parteien profitieren: Die Veteran*innen erhalten Arbeit, terroristische Aktivitäten werden eingedämmt und Tiere werden vor Wilderern geschützt. Dies alles trifft natürlich nur zu, falls Terrorismus tatsächlich durch Wilderei finanziert wird. Ist Kinessa Johnson das Gesicht modernen Naturschutzes?
„Grüner Militarismus“ – die Ansicht, dass die Natur am effektivsten durch Waffengewalt geschützt werden könne – ist kein neues Phänomen: Bereits im 19. Jahrhundert führte die Gründung von Nationalparks wie Yellowstone und Yosemite in den Vereinigten Staaten zu Vertreibung und Gewalt gegen die dort lebenden indigenen Völker. Die Naturschutzbewegung wurde vor allem von wohlhabenden Großwildjägern vorangetrieben, die verhindern wollten, dass „ihre“ Herden von hungrigen Einheimischen gejagt werden. Die seltsame Idee, dass Großwildjäger*innen die besten Naturschützer*innen seien, ist bis heute weit verbreitet. Der Begriff des „Wilderers“ bezeichnet seit jeher nur jene anderen Jäger, die die Naturschützer*innen loswerden wollen.
Organisationen wie VETPAW stellen ihre Arbeit für den Naturschutz als einen Krieg dar, der eine entschlossene Kampfhaltung nötig macht. „Wilderer“ werden als organisierte und erfahrene Akteure dargestellt, die in kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel und Terrorismus verwickelt seien und diese mit Geld versorgen würden. Dies ist verständlich, denn um täglich zwei Millionen US-Dollar an Spendengeldern zu generieren, müssen große Naturschutzorganisationen wie der World Wide Fund For Nature (WWF) auf vereinfachende Narrative zurückgreifen. Dennoch hat die Kriminalisierung von „Wilderei“ fatale Folgen:
In vielen Fällen geht die Kriminalisierung von Wilderei mit der Kriminalisierung indigener Völker einher. Einige indigene Gruppen jagen für ihren Lebensunterhalt und werden infolgedessen von selbsternannten Naturschützer*innen der „Wilderei“ bezichtigt. Sogenannte „Wildhüter“ nehmen dies als Vorwand, um zahlreiche Formen von Missbrauch an indigenen Völkern zu rechtfertigen. So werden indigene Völker wie die Baka in Kamerun, die Buschleute in Botswana und die Adivasi in Indien unter dem Vorwand des „Naturschutzes“ eingeschüchtert, geschlagen und gefoltert.
Die Vereinten Nationen und BirdLife, ein Zusammenschluss von Organisationen zum Schutz der Umwelt, finanzieren in Botswana ein 26-Millionen-Dollar-Projekt, das sich unter anderem gegen „Subsistenzwilderei“ richtet. Damit wird gleichermaßen die Kriminalisierung der Buschleute mitfinanziert, die für ihren Lebensunterhalt auf die Jagd angewiesen sind.
Auch die Baka-„Pygmäen“ in Kamerun wurden im Namen des Naturschutzes von ihrem Land vertrieben. Nach der Vertreibung des indigenen Volkes spielte der WWF bei der Aufteilung ihres angestammten Landes in Safari-Jagdgebiete, Abholzungsgebiete und Nationalparks eine wichtige Rolle. Die Nichtregierungsorganisation ignoriert standhaft Anfragen zur Freigabe von Unterlagen, die zeigen würden, wie sie sich mit anderen Beteiligten über die Aufteilung des Landes geeinigt hat. Zudem behauptet der WWF fälschlicherweise, dass die Baka ihrer Vertreibung von ihrem angestammten Land zugestimmt hätten.
Die Kriminalisierung indigener Völker beruht zu einem großen Teil auf unhaltbaren Anschuldigungen. So behauptete die botswanische Regierung 2002, als sie die Buschleute von ihrem Land vertrieb, dass die Indigenen von Lastwagen aus mit Schnellschusswaffen jagen würden. Diese Aussage wurde von Partnern der Regierung gestützt, darunter auch Mitglieder des britischen Parlaments. Vor Gericht gaben Beamte schließlich zu, dass die Aussage frei erfunden sei – tatsächlich jagen die Buschleute mit Speeren oder mit Pfeil und Bogen und stellen keine Bedrohung für den Erhalt der Artenvielfalt Botswanas dar. Trotz derartiger Anschuldigungen gegen Botswanas indigene Bevölkerung wird der Präsident, General Khama, für sein jüngstes landesweites Jagdverbot gelobt – ein Verbot, das darüber hinaus eine Verletzung der botswanischen Verfassung darstellt.
Obwohl das Jagdverbot per Gesetz für alle gilt, handelt es sich in erster Linie um einen erneuten Versuch, die Buschleute von ihrem angestammten Land zu vertreiben. Denn wohlhabende Tourist*inneen können auf Botswanas privaten Wildtier-Farmen, die vom Jagdverbot ausgeschlossen sind, weiterhin Großwild schießen. So werden indigene Völker durch Verhaftung und Prügel daran gehindert, ihre Familien zu ernähren, während Tourist*inneen zur eigenen Unterhaltung weiterhin auf Trophäenjagd gehen dürfen.

Botswana ist eines von vielen touristischen Reiseländern mit Regelungen, die bei Sichtung eines Wilderers sofortiges Schießen („shoot-on-sight“) erlauben. Es ist oft unmöglich festzustellen, was wirklich passiert ist, wenn Parkwächter „Wilderer“ töten: Die Ranger behaupten stets, sie seien zuerst beschossen worden, und kein*e Lebende*r kann ihnen widersprechen. Doch in einigen Fällen können die Berichte der Wächter zu einem späteren Zeitpunkt durch Beweise widerlegt werden.
Vor einigen Monaten berichtete zum Beispiel die simbabwische Parkbehörde davon, dass eine Gruppe von drei Menschen mit einer Großkaliberwaffe auf Wächter im Matusadona-Nationalpark geschossen habe. Zwei Personen wurden sofort von Wächtern erschossen, die Dritte konnte fliehen. Später berichteten die Beamten, was sie vorfanden: ein .303-Gewehr, sieben Ladungen Munition, einen Kochtopf und etwas Büffelfleisch, wie es überall in Afrika in Restaurants serviert wird.
Tatsächlich handelt es sich bei dem .303-Gewehr nicht um eine Großkaliberwaffe, sondern um ein altes Gewehr der britischen Infanterie, das vor nicht weniger als 120 Jahren eingeführt wurde. Wäre Wilderei so lukrativ wie behauptet wird, hätte diese „Wilderei-Einheit“ sicher zu etwas Modernerem gegriffen, das mehr Munition fasst. Es handelt sich keineswegs um einen Einzelfall: 2014 wurden zwei Männer im Sambesi-Nationalpark in Sambia getötet. In diesem Fall wurden weder Waffen noch Munition gefunden. Laut Verwandten waren die Opfer unbewaffnet gewesen und hatten Holz gesammelt. In einem weiteren Fall wurden botswanische Soldaten beschuldigt, ein Verbrechen vorgetäuscht zu haben, indem sie Stoßzähne neben den Leichen dreier von ihnen erschossener Männern platzierten. Die Anzahl ähnlicher Berichte nimmt zu.
Dabei ist das Phänomen nicht auf Zentralafrika begrenzt. Einheimische in der Nähe des Kaziranga-Nationalparks in Indien werden Berichten zufolge dafür bezahlt, Vorfälle von „Wilderei“ an die Behörden zu melden. Wird in Folge solcher Anschuldigungen jemand getötet, erhält der Informant bis zu 1.000 US-Dollar – vor Ort ein kleines Vermögen und ein großer Anreiz, den Finger auf jemanden zu richten. Das bedeutet: Menschen werden außergerichtlich hingerichtet, wenn ein Dritter auf Basis finanzieller Eigeninteressen behauptet, sie würden ein Verbrechen planen. Die Wildhüter dagegen genießen Immunität gegenüber Strafverfolgung.
Viele westliche Naturschützer*innen begrüßen extreme Mittel, wenn es etwa um den Schutz von Elefanten vor indigenen Jägern geht. Dabei jagen Naturschützer*innen oft selbst Elefanten – auch hier wird mit zweierlei Maßstab gemessen.
2014 etwa versteigerte der Dallas Safari Club, der sich auf seiner Website unter anderem als Sammelpunkt für Jäger*innen und Naturschützer*innen vorstellt, die Lizenz zur Tötung eines vom Aussterben bedrohten Spitzmausnashorns. Der Club ist inzwischen vollwertiges Mitglied der Weltnaturschutzunion, einem Partner des WWF.
Naturschützer*innen jagen selbst Elefanten – dies kann aus Sicht des Naturschutzes mancherorts sinnvoll sein. Es wird angenommen, dass Botswanas Chobe-Nationalpark sieben Mal mehr Elefanten beherbergt als er tragen kann, was einen katastrophalen Verlust der Pflanzen- und Tiervielfalt zur Folge hat. Nun, da die traditionellen indigenen Jäger durch Umweltschutzbestimmungen größtenteils ausgelöscht wurden, ist es ganz und gar nicht im Sinne der Umwelt, wenn sich das größte Landtier der Welt unkontrolliert vermehrt.
Wie willkürlich die Unterscheidung zwischen legitimer „Jagd“ und illegitimer „Wilderei“ ist, wird am Beispiel von Geoffroy de Gentile Duquesne deutlich. Er wurde von der spanischen Firma Mayo Oldiri beauftragt, einen Jagdsportverein in einem „Schutzgebiet“ in Kamerun anzuleiten. Unter seinen Kunden war der Südafrikaner Peter Flack, der Jagd auf vom Aussterben bedrohte Waldelefanten machte. In der Beschreibung seines teuren Abenteuers im Jahr 2012 schrieb Flack, dass er ein unversehrtes Tier für Ausstopfungszwecke habe erlegen wollen. Der ehemalige Bergbaumagnat, dem sechs Jahre vor seinem Ausflug 2012 von der Confederation of Hunting Associations of South Africa der Preis „Jäger des Jahres“ verliehen wurde, ist Treuhänder des WWF.

Duquesne hat jedoch nicht nur reiche Jäger wie Flack auf der Jagd nach Großwild angeleitet: Er hat auch einen angeblichen Wilderer erschossen – aus „Notwehr“, wie er selbst sagt. Mit anderen Worten: Manche Naturschützer*innen töten sowohl Elefanten als auch ihre Wilderer.
Dies führt den Naturschutz zurück zu seinen historischen Wurzeln: Zu dem Versuch, arme Menschen davon abzuhalten, für ihren Lebensunterhalt zu jagen, und das Wild ausschließlich den Reichen vorzubehalten. Der Begriff „Wilderer“ erfährt derzeit eine Ausdehnung: Er reicht von organisierten und hochgradig erfolgreichen Banditen bis hin zu indigenen Völkern, die versuchen, ihre Familien zu ernähren. Aber schließt er auch solche mit ein, die Terroristen finanziell fördern, wie Unterstützer von „Shoot-to-kill“-Strategien regelmäßig betonen?
Rosaleen Duffy von der Londoner School of Oriental and African Studies hat sich dieser Frage eingehend gewidmet. Sie hat herausgefunden, dass sich die Behauptung, dass Terrorismus durch Wilderei finanziert werde, auf einen einzigen Artikel stützt. Dieser Artikel wurde ursprünglich 2012 auf der Website der Elephant Action League veröffentlicht und verweist auf die Finanzierung der Terrorgruppe Al-Shabaab in Somalia durch Elfenbeinhandel.
Laut den Autoren fand ihre „erste Begegnung“ mit Wilderern in einem Hotel in Nairobi statt. Wie sie schreiben erforderte „die Verfolgung der Elfenbeinspur der Shabaab nach Somalia (…) die Hilfe mutiger einheimischer Somali“, was impliziert, dass sie in Somalia waren, auch wenn sie dies nicht ausdrücklich sagen. Ihre Informanten sind wie zu erwarten anonym und es gibt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob der Bericht der Wahrheit entspricht.
Der Artikel ist gefüllt mit Modalfunktionen (– „es könnte sein“, „vielleicht“, „eventuell“ und so weiter –), aber ein konkretes Detail taucht auf: Die Wilderer erzählten ihnen demnach, dass Al-Shabaab monatlich mit Elfenbein im Wert von 200.000 bis 600.000 US-Dollar unterstützt werde. Es ist der höhere Wert, der zu einem Mantra der Naturschützer*innen wurde, wobei es angemessener wäre, den Durchschnitt heranzuziehen: Das wären insgesamt fast fünf Millionen US-Dollar pro Jahr, die durch Wilderei an Al-Shabaab gingen. Kalron und Crosta, die Autoren des Artikels, behaupten zudem, dass durch Wilderei erwirtschaftetes Geld „bis zu 40 Prozent der Mittel bereitstellen könnte, die Al-Shabaab benötigt, um im Geschäft zu bleiben“. Aber stimmen die Zahlen?
Es wird angenommen, dass die Gruppe hunderte Millionen US-Dollar aus verschiedenen Quellen erhält: unter anderem aus „Steuern“ und Lösegeldern, die sie in Seehäfen eintreibt, von wohlgesonnenen Regierungen und von internationalen Firmen in somalischem Besitz.
Selbst wenn Al-Shabaab tatsächlich fünf Millionen US-Dollar pro Jahr durch Elfenbein verdienen würde, könnte der Elfenbeinhandel keineswegs als eine der Haupteinnahmequellen der Organisation bezeichnet werden. Es wird angenommen, dass es sich bei dieser Summe um nur 12 % der Einnahmen handelt, die Al-Shabaab nach Schätzungen der UNO durch „Steuereinnahmen“ eintreibt – was wiederum nur eine der Einnahmequellen der Terrororganisation ist.
In jedem Fall muss hervorgehoben werden, dass Andrea Crostas und Nil Kalrons Artikel die einzige Quelle ist, die Rosaleen Duffy für die Verbindung zwischen Wilderei und Terrorismus finden konnte, und dass die Autoren dieses Artikels am Einsatz von Paramilitärs im Naturschutz beteiligt sind.
Nir Kalron, der Hauptautor des Artikels, ist ein ehemaliger Elitesoldat und Leiter der Sicherheits- und Risikoberatungsfirma Maisha Consulting, die Waffentraining anbietet und mit dem WWF und der Wildlife Conservation Society (früher New York Zoological Society) kooperiert. Kalron selbst äußerte sich über sein Unternehmen folgendermaßen: „Es ist jedem klar, dass wir keine Gutmenschen von irgendeiner gemeinnützigen Organisation sind, die die Leute freundlich darum bitten, sich um die Umwelt zu kümmern.“
Selbst wenn wir annehmen, dass Kalrons Zahlen realistisch sind, hätte die Beendigung des Elfenbeinhandels der Al-Shabaab nur eine geringe Auswirkung auf den Etat der Terroristen. Ob die geschätzte Summe von fünf Millionen US-Dollar pro Jahr realistisch ist, ist jedoch unklar. Weder die Vereinten Nationen noch INTERPOL glauben, dass Al-Shabaab wesentliche Summen durch Wilderei einnimmt.
Eigentlich sollte es die oberste Priorität von Naturschützer*innen sein, Einheimische auf ihrer Seite zu wissen – insbesondere jene, die das Land seit Generationen bewohnen und die örtliche Umwelt um so vieles besser kennen als jede*r Naturschützer*in. Dennoch ist das genaue Gegenteil der Fall: Indigene Völker werden aktiv aus dem Naturschutz ausgeschlossen und anhand unhaltbarer Anschuldigungen kriminalisiert. Sie werden im Namen des Naturschutzes von dem Land vertrieben, das ihre Lebensgrundlage darstellt, und sind Missbrauch und Tötungen durch bewaffnete Wildhüter ausgesetzt.
Es wird Zeit für die Naturschutzbewegung, anzuerkennen, dass indigene Völker die besten Umweltschützer und Wächter der Natur sind. Sie sollte mit ihnen zusammenzuarbeiten anstatt gegen sie. Es wird Zeit für Naturschutzorganisationen, ihre Vergangenheit und die Vertreibung indigener Völker aufzuarbeiten. Und es wird Zeit für Naturschützer*innen, die Menschenrechte indigener Völker zu respektieren.