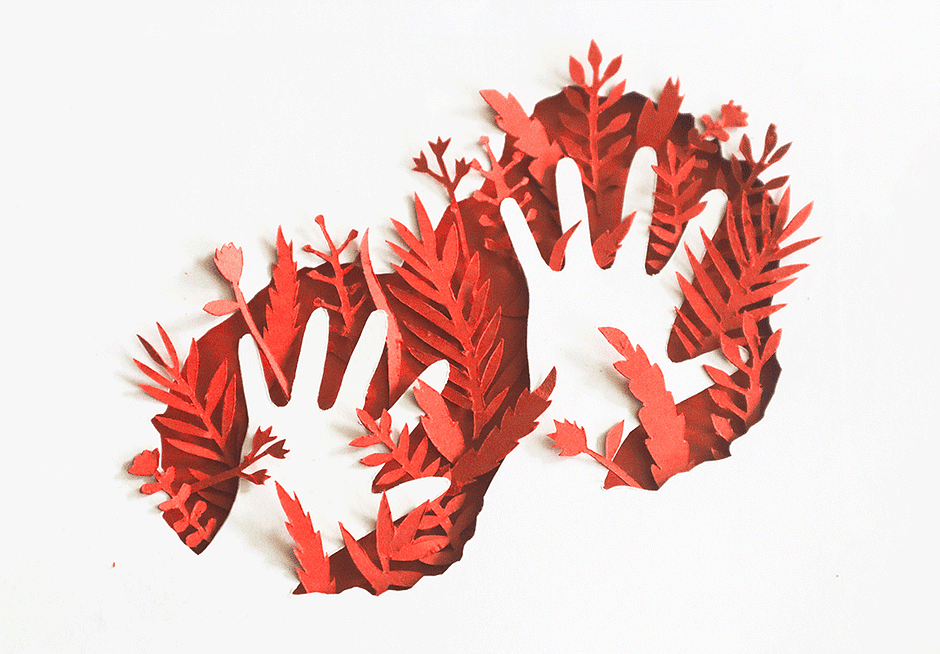Vom Ignorieren „reiner, alter Schwingungen“
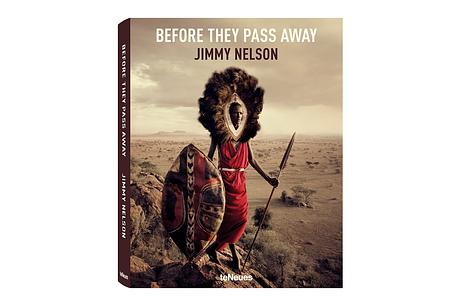
Rezension von Jimmy Nelsons „Before they pass away“
geschrieben von Stephen Corry
Die Originalversion dieses Artikels erschien am 01. Juni 2014 auf Truthout.
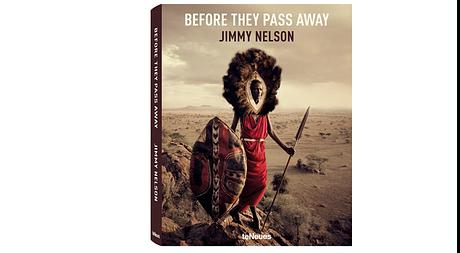 © Jimmy Nelson/teNeues
© Jimmy Nelson/teNeues
Es gibt hunderte großformatige Bildbände über indigene Völker, darunter jedoch vielleicht keines so extrem – oder bizarr – wie Jimmy Nelsons „Before they pass away“ (teNeues, 2013). Mit rund 5 kg ist Nelsons Portrait indigener Völker sicherlich der größte Bildband seiner Art – und bei einem Preis von 128 Euro auch der teuerste. Im Vergleich zur Sammlerausgabe (6.500 Euro) handelt es sich bei der Standardausgabe jedoch noch um ein „Schnäppchen“.
Nelson, so erfahren wir, machte sich auf die Reise um „nach alten Zivilisationen zu suchen … und ihre Reinheit an Orten zu dokumentieren, wo unberührte Kulturen noch existieren“. Auf seiner Webseite erfahren wir außerdem, dass er die letzten Stammesangehörigen „aufgestöbert und beobachtet” habe: „Er lächelte und trank ihre mysteriösen Gebräue. Er nahm Anteil an etwas, das Menschen wirklich verbindet: an Schwingungen, die unsichtbar, aber dennoch spürbar sind. Auf diese Frequenz richtete er seine Antennen aus. Als das Vertrauen (der indigenen Völker) wuchs, entstand ein gemeinsames Verständnis der Mission: Niemals darf die Welt vergessen, wie alles war.“ Natürlich waren die „Kulturen“, die er vorfand, angeblich „seit tausenden von Jahren unverändert“.
Nelsons fragwürdige „Mission“ resultierte in zweifellos schönen und effektvollen Fotografien einiger Dutzend indigener Völker, die mit einer Großformatkamera aufgenommen wurden. Die Modelle sind in Stellung gebracht, als stünden sie in jenen Werbeagenturen vor der Kamera, in denen Nelson seine Karriere begann. Die „Stammesvölker“ (unter denen aus unbekannten Gründen auch Tibeter und südamerikanische Cowboys zu finden sind) werden zum Großteil so portraitiert, dass sie „uns“ so exotisch und anders erscheinen wie nur möglich. Dies gilt nicht nur in Bezug auf Kleidung und Schmuck, sondern auch in Bezug auf die Posen, welche die Modelle einnehmen sollen: Für eine Gruppe Indigener in Vanuatu ersann Nelson beispielsweise die Idee, sie alle auf einen Baum zu setzen.
Dies führt zu einer der Fragen, die Nelsons Bildband problematisch macht: Sind diese Darstellungen realistische Portraits indigener Völker oder entspringen sie lediglich der Fantasie eines Fotografen?
Menschen anderer Herkunft so exotisch wie möglich darzustellen ist ein uralter Kunstgriff. Ein besonders einflussreicher Vertreter dieser Tradition war Edward Curtis, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts nordamerikanische Indigene fotografierte (und mit dem sich Nelson häufig vergleicht). Bis heute gehen unsere Vorstellungen von amerikanischen Ureinwohner*innen weitgehend auf Curtis’ Darstellungen aufsehenerregender, menschlicher Schönheit und Erhabenheit zurück.
Wie viele Fotografen vor ihm wollte Curtis nicht, dass Gegenstände, die in westlichen Nationen gefertigt wurden, seine Darstellungen verderben – solche Gegenstände wurden daher entweder vor den Aufnahmen oder später in der Dunkelkammer entfernt. Sowohl in Curtis Aufnahmen als auch in seinen Texten werden indigene Völker so dargestellt, als hätten sie mindestens eine Generation vor dem Betrachter gelebt. Männer werden ausnahmslos als „tapfere Kämpfer“ oder eine „Kriegspartei“ dargestellt und werden meist mit kompletten zeremoniellen Insignien gezeigt. Diese Masche, die ich den „Curtis-Kunstgriff“ nenne, ist in bildlichen Darstellungen indigener Völker allgegenwärtig. Sie kann jedoch schädlich sein – insbesondere dann, wenn ihr realer Kontext beschönigt wird, worauf ich später noch eingehen werde.
Zunächst jedoch zur Frage, wie „echt“ Nelsons Portraits sind. In seinen Bildern der Waorani in Ekuador sind diese bis auf ihr traditionelles Hüftband unbekleidet. Die Indigenen wurden hier nicht nur ihrer alltäglichen Kleidung beraubt, sondern auch anderer in Fabriken hergestellter Schmuckwaren wie Uhren und Haarklammern. In Wirklichkeit tragen kontaktierte Waorani seit mindestens einer Generation gewohnheitsmäßig Kleidung – es sei denn, sie „verkleiden“ sich für Touristen. Nelsons Bilder wurden alle in einer Gemeinde am Fluss Cononaco gemacht, die seit den 1970er Jahren von zahlreichen Touristen besucht wird. In diesem Fall ahmt Nelson jedoch nicht einfach Curtis nach, indem er Völker portraitiert, wie sie vor einer oder zwei Generationen ausgesehen haben: Seine weiblichen Waorani-Modelle wurden außerdem dazu angehalten, sich Feigenblätter an ihre Hüftbänder zu binden, was sie früher niemals getan hätten. Die Bilder erwecken also den Eindruck, man würde in vergangene Zeiten zurückversetzt, obwohl es sich in Wirklichkeit um zeitgenössische Erfindungen eines britischen Fotografen handelt.
 © Jimmy Nelson/teNeues
© Jimmy Nelson/teNeues
All dies ist auch deshalb relevant, weil Nelson angibt, „ethnografische Fakten“ darzulegen. Er geht sogar noch weiter und behauptet kühn, dass seine Arbeit etwas wiedergebe, was andere nicht zu vermitteln in der Lage gewesen seien. Nelsons Portraits, so möchte er uns glauben machen, führen die Leserin oder den Leser näher an indigene Völker heran als andere Darstellungen. Es handelt sich hierbei um anmaßenden Unsinn, der vermutlich von Nelsons Publizisten ersonnen wurde und von dem man nur hoffen kann, dass er wenige vernünftige Betrachter in die Irre führt.
Es gibt ein weiteres Problem: Die dargestellten Völker, so wird uns bereits im Titel versichert, sind „dabei, zu verschwinden“. Das Buch, so Jimmy Nelson, handle nicht von ihm selbst, sondern sei ein „Katalysator für etwas viel Größeres (…). Wenn wir eine globale Bewegung starten könnten, die Bilder, Gedanken und Geschichten über das frühere und heutige Stammesleben dokumentiert (…), könnten wir vielleicht einen Teil des wertvollen kulturellen Erbes unserer Welt vor dem Verschwinden bewahren.“
Dieses leere Mantra oder Variationen davon sind inzwischen Teil der Probleme geworden, mit denen sich indigene Völker konfrontiert sehen: Angeblich können sie „gerettet“ werden, indem man sie fotografiert. Es suggeriert, dass ihr „Verschwinden“ der natürliche und unvermeidliche Gang der Geschichte sei, der vielleicht betrauert werden könne, dem man sich aber nicht widersetzen solle. Wenn wir diesem Narrativ Glauben schenken, gibt es keinen Grund mehr, gegen die Auslöschung indigener Völker zu kämpfen. Wie Knut der Große vor tausend Jahren bekanntermaßen verkündete, ist es sinnlos, gegen das unerbittliche Rad der Zeit und der Gezeiten anzukämpfen.
In Wirklichkeit sind viele Minderheiten, insbesondere indigene Völker, nicht „dabei, zu verschwinden“: Sie werden zum Verschwinden gebracht, durch „unseren“ illegalen Raub ihres Landes und ihrer Ressourcen. Die Mursi in Äthiopien – laut Nelson „ein Volk, das als recht primitiv angesehen wird“– werden derzeit von ihrem Land vertrieben, um der staatlichen Agrarindustrie Platz zu machen, was im Buch keinerlei Erwähnung findet. Die Völker im Omo-Tal – die Nelson zufolge „ein einfaches Leben führen“ – sehen sich mit „ernsten Sorgen um die Auswirkungen eines gigantischen Staudamms“ konfrontiert, wie Nelson es ausdrückt. Um es deutlich zu machen: Diese „Sorgen“ bestehen darin, dass die Völker im Omo-Tal von ihrem Land vertrieben und, falls sie sich dagegen wehren, geschlagen und inhaftiert werden. All dies geht vom Staat Äthiopien aus, einem der größten Empfänger von Entwicklungshilfegeldern aus den USA und Großbritannien.
Es handelt sich um ein wiederkehrendes Muster: Auch Nelsons Abschnitt über die Tibeter enthält keinerlei Hinweise darauf, dass China 1950 in das Land einfiel, es annektierte und die gewaltsame Besetzung Tibets bis heute aufrechterhält. Das gleiche gilt für die Völker Westpapuas, deren Angehörige unter der indonesischen Besetzung vergewaltigt und getötet wurden – auch dies findet in Nelsons Buch keinerlei Erwähnung. Stattdessen erfahren wir, dass die Dani „das gefürchtetste kopfjagende Volk Papuas genannt wurden“ („Kopfjagd“ bezeichnet die rituelle Tötung eines Menschen, um den Schädel als Siegestrophäe zu erbeuten). Hierbei handelt es sich um weiteren beleidigenden Unsinn, der von Unternehmern kolportiert wird, um leichtgläubige Touristen anzuziehen: Die Dani sind und waren keine „Kopfjäger“. Benny Wenda, ein Vertreter des Volkes, bittet eindringlich: „Es wird Zeit, dass diese Lügen über uns gestoppt werden. Die Menschen müssen erkennen, dass es in Wahrheit die indonesische Regierung ist, die barbarisch handelt.“ Wir erfahren von Nelson auch, dass es sich beim unabhängigen Land Papua-Neuguinea um „einen grausamen Ort mit von Natur aus wilden Menschen“ handle. Dass Nelson das Land für „wild“ hält erscheint verständlich, arbeitet der britische Fotograph doch in dem Glauben, die meisten indigenen Papua äßen ihre Feinde.
Vielleicht erkennen Sie das Muster: Irgendwo an einem entfernten Ort leben „reine“, aber „von Natur aus wilde“ Völker – und wir sollten Nelson dankbar sein, dass er die Anstrengungen seiner Pilgerfahrten auf sich nimmt um uns – zu einem erheblichen Preis – mit den „unsichtbaren, aber dennoch spürbaren“ Schwingungen dieser Völker zu beschenken, ehe sie für immer verschwinden.
Ironischerweise sind trotz der Verbrechen, die an indigenen Völkern begangen werden, wenige der von Nelsons portraitierten Völker tatsächlich „am Dahinscheiden“. Die Waorani, über die Nelson absurderweise behauptet, sie würden „sich … als das mutigste Volk des Amazonas an(sehen)“, sind ein gutes Beispiel: Obwohl sie dabei zusehen mussten, wie ein Großteil ihres Gebietes durch die Förderung von Erdöl zerstört wurde, hat sich ihre Zahl seit meinem letzten Besuch vervierfacht.
Der kriminelle, oft völkermörderische Umgang mit indigenen Völkern wird durch die Ansicht, dass ihr Untergang unvermeidbar sei, weiter gefördert. Wir müssen aufhören, Verbrechen gegen die Menschheit bloß als eine weitere historische Zwangsläufigkeit zu sehen und ihren Fortbestand damit gleichermaßen zu akzeptieren.
Verbrechen an indigenen Völkern, wie sie etwa in Äthiopien und West-Papua stattfinden, sollten nicht aus den Portraits dieser Völker heraus retuschiert werden. Es handelt sich um Gräueltaten, die öffentlich gemacht werden müssen und gegen die sich jeder richten sollte, der an fundamentale Menschenrechte glaubt.
Nelsons Darstellung indigener Völker ist keine Lösung – sie ist vielmehr Teil des Problems. Wenn seine Bilder aussehen, als stammten sie aus dem 19. Jahrhundert, dann liegt es daran, dass sie es sind: Sie sind der Widerhall einer kolonialen Vision, die nach wie vor zutiefst zerstörerisch für indigene Völker ist. Nelson wird seine „Antenne“ erneut ausrichten müssen. Denn was immer seine Arbeit auch sein mag: Um „unersetzliche ethnografische Aufzeichnung einer schnell verschwindenden Welt“ handelt es sich sicher nicht.